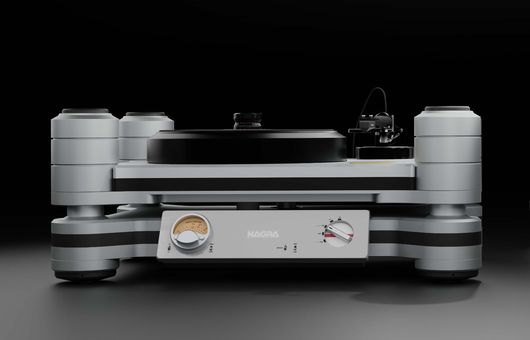Wie kommt man zu einem fundierten und reproduzierbaren Qualitätsurteil über Geräte, Lautsprecher, Zubehör und Tonformate? Technische Systeme lassen sich anhand von Messkriterien einordnen, aber auch gehörmässig beurteilen. Eine banale Erkenntnis.
Anbieter von Geräten, die messtechnisch nicht so brillieren, insistieren, dass unser Gehör das massgebende Organ sei, viel mehr Auflösung habe und somit ein präziseres und letztendlich relevanteres Urteil liefere. Hoppla, das ist mal eine Ansage, die Messwerte als Grobfaktor zwar anerkennt, dem aber keine oder nur geringe Aussagekraft attestiert. Folglich: Geräte mit schlechten Messresultaten müssen nicht schlecht klingen. Wirklich?
Ist Messen oder Hören präziser? Eine Frage mit Zündstoff
Der Autor stellt hier mal die Gegenposition zur Diskussion: Ein Gerät mit schlechten Messresultaten klingt auch schlechter. Und schon sind wir mit diesem und dem obigen Beurteilungsansatz in der Sackgasse: Ein Set von Messresultaten, welche die Qualität eines Produktes belegen soll, wird mit dem Hörsystem des Menschen beurteilt.
Wenn nun aber dieses Hörsystem weniger präzis, weniger zuverlässig ist und keine objektiv reproduzierbaren Urteile liefert, dann kann das Hörsystem die Relevanz der Messung weder bestätigen noch widerlegen. Die Beurteilung wäre subjektiv, individuell, von Präferenzen beeinflusst und läge in einem grösseren Streubereich, wenn mehrere Hörer das Gleiche beurteilen. Sie sehen: Hier liegt das Minenfeld für hitzige Diskussionen, wie «die Schallplatte ist besser als die CD» – ein Evergreen seit 1983. Lässt sich die Überlegenheit der menschlichen Hörfähigkeit objektiv nachweisen und somit Messwerte als sekundär oder vernachlässigbar einstufen?
Die Ausgangslage
Um aus diesem Zirkelschluss zu kommen, müssen wir zunächst mal die Stärken und Schwächen von Mess- und Hörbeurteilung ermitteln. Beginnen wir mit dem Messen:
Ein Audiogerät lässt sich mit vier primären Messgrössen (Metadaten) beschreiben: Frequenzgang, Verzerrungen, Rauschen und zeitbasierte Fehler. Dies gilt gleichermassen für analoge wie digitale Systeme. Beispiel: Die analogen Gleichlaufschwankungen und der Jitter in der digitalen Domäne sind beides zeitbasierte Fehler. Unterschiedlich ist nur, wie die Werte gemessen werden: die Messmethode, Messgrössen und die Hörschwelle.
Messwerte sind – die korrekte Messmethode vorausgesetzt – numerische Grössen, als Zahlenreihen oder Grafiken dargestellt, die definiert und reproduzierbar sind. Ein Pegelmessgerät kann uns den momentan vorhandenen Schalldruck in einem Raum als genauen dB-Zahlenwert angeben, während der Mensch höchstens eine grobe Schätzung liefern kann.
Die Messwerte aus Frequenzgang, Verzerrungen, Rauschen und zeitbasierten Fehlern sind Zahlensammlungen ohne Emotionen, die zueinander in Beziehung gebracht und verstanden werden müssen. Für Nicht-Techniker eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Und selbst der kompetenteste Audioingenieur wird ohne Hören und Vergleichen nicht zu einem umfassenden, brauchbaren Urteil kommen.
Das menschliche Hörsystem
Das menschliche Hörsystem ist eine komplexe Angelegenheit. Die aufs Trommelfell eintreffenden Schallwellen werden über winzige Knöchelchen (Hammer, Amboss, Steigbügel) an die Hörschnecke (Cochlea) geleitet, welche über die Flimmerhärchen den Schall in Nervenimpulse umwandelt, die ins Hirn geleitet werden. Und dort entsteht unsere Hörwahrnehmung und folglich auch Emotionen. Dies ist ein äusserst komplexer Vorgang.


 Alle Themen
Alle Themen