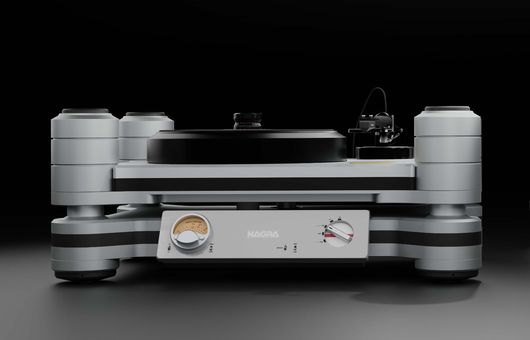Die Canon EOS R5 ist ein heisses Teil – und dies gleich in dreifacher Hinsicht. Zum ersten ist die Kamera heiss begehrt, zum zweiten ist sie momentan die am besten ausgestattete spiegellose Vollformatkamera in ihrer Liga und zum dritten tendiert sie beim 8K-Videofilmen schnell mal zur Überhitzung.
Etwas weniger heiss geht es bei der Canon EOS R6 zu, die im allgemeinen Hype um den grossen Bruder beinahe untergeht. Sie muss sich jedoch überhaupt nicht verstecken und beeindruckt mit ähnlich coolen Eigenschaften wie die R5.
So basieren beide Kameras auf der Digic-X-Prozessortechnologie des High-End-Modells EOS-1D X Mark III, besitzen einen CMOS-Sensor im Kleinbildformat und – erstmalig für Canon – eine integrierte 5-Achsen-Bildstabilisierung IBIS («In Body Image Stabilization»). Ein Dual-Pixel-Autofokus der zweiten Generation mit Gesichts- und Augenerkennung sowohl bei Personen wie auch bei Tieren ist ebenso eingebaut wie die Möglichkeit, mit bis zu 12 oder mit dem lautlosen elektronischen Verschluss sogar bis zu 20 Bilder pro Sekunde zu schiessen.
Beide Kameras können in 4K/UHD-Video mit bis zu 60p, mit Canon-Log oder in HDR filmen. Wer mehr Auflösung beim Fotografieren oder Filmen benötigt, muss zur EOS R5 greifen. Sie bietet mit rund 45 Megapixel eine mehr als zweifach so hohe Bildauflösung wie die R6 mit ihren 20,1 Megapixeln. Ähnlich sieht es beim bewegten Bild aus, wo die EOS R5 mit ihrer 8K-Videoauflösung (7680 x 4320 oder 8192 x 4320 Pixel) gleich vier Mal so viele Daten wie die R6 mit maximal 4K/UHD (3840 x 2160 Pixel) liefert.
 Von hinten kaum zu unterscheiden: Die Anordnung der Bedienungselemente auf der Rückseite ist bei der Canon EOS R6 (links) und der EOS R5 identisch. Neu gibt es wieder einen Joystick gleich rechts vom Sucher.
Von hinten kaum zu unterscheiden: Die Anordnung der Bedienungselemente auf der Rückseite ist bei der Canon EOS R6 (links) und der EOS R5 identisch. Neu gibt es wieder einen Joystick gleich rechts vom Sucher.Ausstattung optimiert
Auch in der äusseren Erscheinung unterscheidet sich das Duo im Millimeter-, nein, sogar nur im Zehntelsmillimeterbereich. Laut Handbuch misst die EOS R5 138,5 x 97,5 x 88,0 mm, während die EOS R6 mit 138,4 x 97,5 x 88,4 ganz wenig schmaler, dafür etwas tiefer gebaut ist. Gegenüber dem Vorgänger EOS R sind beide Kameras unmerklich grösser, aber immer noch sehr handlich und kompakt. Betriebsbereit mit Akku und Speicherkarte wiegt die EOS R5 738 Gramm und damit knapp 60 Gramm mehr als die EOS R6.
Der ausklappbare und nach vorne drehbare Monitor der EOS R wurde bei den beiden Neuen ebenso übernommen wie die Bedienungselemente auf der Rückseite. Mit Ausnahme der ungeliebten Touch-Leiste und dem Steuerkreuz, dessen Funktionen wieder ein Joystick und das klassische Drehrad übernehmen. Damit fühlen sich nun auch Canon-DSLR-Benutzer sofort zuhause. Vielen Dank, Canon!
Wenn wir schon beim Beheben von Mängeln der EOS R sind: Die R5 wie die R6 sind mit zwei Speicherkarten-Slots ausgestattet. Damit lassen sich Daten zur Sicherheit parallel auf zwei Karten aufzeichnen. Ein Detail, worauf vor allem Hochzeitsfotografen enorm viel Wert legen.
Während sich die EOS R6 mit SD-Speicherkärtchen begnügt, werden bei der EOS R5 zur Aufzeichnung von 8K-RAW- und 4K-120p-Videos in ALL-I-Komprimierung zwingend die teuren CFexpress-Karten vom Typ-B benötigt. Diese Karten benutzt bereits die Spiegelreflexkamera Canon EOS-1D X Mark III. Dementsprechend ist die EOS R5 neben einem SD-Kartenfach, das UHS-II- und UHS-I-Karten unterstützt, auch mit einem Fach für CFexpress-Karten ausgestattet.
 Speicher-Express: Die Canon EOS R5 (rechts) unterstützt im Kartenfach 1 die schnellen und robusten CFexpress-Karten vom Typ B, die etwas grösser als die SD-Karten sind. Die Canon EOS R6 bleibt bei den bekannten SD-Speicherkärtchen.
Speicher-Express: Die Canon EOS R5 (rechts) unterstützt im Kartenfach 1 die schnellen und robusten CFexpress-Karten vom Typ B, die etwas grösser als die SD-Karten sind. Die Canon EOS R6 bleibt bei den bekannten SD-Speicherkärtchen.Zur Stromversorgung kommen bei beiden Kameras die neuen Akkus vom Typ LP-E6NH zum Einsatz. Ältere Modelle wie der LP-E6N (1865 mAh) oder der bewährte «Urahn» LP-E6 (1800 mAh) können ebenfalls eingesetzt werden, halten jedoch nicht so lange durch wie der neue mit seiner Kapazität von 2130 mAh. Ein separates Akku-Ladegerät ist im Lieferumfang beider Kameras enthalten.
Die Akkus LP-E6NH und LP-E6N dürfen auch per USB-C-Anschluss in der Kamera geladen werden. Leider ist diese Variante wie schon bei der EOS R sehr wählerisch, was USB-Ladegerät oder USB-Powerbanks angeht. Von meinen drei Geräten funktionierte kein einziges. Hier möchte Canon wohl seinen eigenen (teuren) USB-Netzadapter PD-E1 verkaufen.
In Internet-Foren wird auf günstigere Alternativen hingewiesen und generell empfohlen, ein USB-Netzteil mit genügend starker Leistung zu verwenden und bei Powerbanks auf Produkte mit der Bezeichnung «Power Delivery (PD)» und direktem USB-C-Anschluss zu achten. Damit sind dann auch längere Foto- oder Video-Sessions ohne Akkuwechsel möglich. LP-E6-Akkus können zwar in der EOS R5 und R6 verwendet, aber nicht per USB geladen werden.
Kontakt nach aussen
An beiden Kameras gibt es auf der linken Seite je eine 3,5-mm-Klinkenbuchse für ein externes Mikrofon und einen Kopfhörer, einen USB-Typ-C-Anschluss und einen HDMI-Ausgang. Letzterer leider nur in der störungsanfälligen Micro-Ausführung. Und wo sich bei der EOS R6 die Fernbedienungsbuchse befindet, sitzt bei der EOS R5 ein «PC»-Blitzsynchronanschluss (Prontor-Compur). Die Buchse für optionale Fernsteuer- oder Timer-Auslösekabel wurde bei der R5 auf die Kamerafront gelegt.
Wie den meisten Profikameras fehlen auch den beiden Neuen ein eingebautes Blitzgerät. Sie sind jedoch mit der übrigen Canon-Welt kompatibel. EOS-Systemzubehör und Speedlite-Blitzgeräte können angeschlossen werden. Um Blitze zünden zu können, muss der Auslöser auf «Mechanisch» oder «Elek.1.Verschl.» stehen, rein «elektronisch» lassen sie sich nicht auslösen.
 Ähnlich kontaktfreudig: Die Canon EOS R (links) verfügt noch über den robusten Mini-HDMI-Anschluss, bei der Canon EOS R5 ist die störungsanfällige Micro-HDMI-Buchse eingebaut. Dafür besitzt sie zusätzlich einen «PC»-Blitzsynchronanschluss (ganz unten).
Ähnlich kontaktfreudig: Die Canon EOS R (links) verfügt noch über den robusten Mini-HDMI-Anschluss, bei der Canon EOS R5 ist die störungsanfällige Micro-HDMI-Buchse eingebaut. Dafür besitzt sie zusätzlich einen «PC»-Blitzsynchronanschluss (ganz unten).Altglas-Verwertung
Nicht jeder Canon-Fotograf wird sich zu einer EOS R5 oder R6 auch gleich noch neue Optiken zulegen wollen oder können. Dies ist auch nicht nötig, denn ein schon vorhandener Canon-Objektiv-Park lässt sich mit den EF-EOS-R-Bajonettadaptern weiterhin verwenden.
Es gibt den normalen «nackten» Adapter, eine Version mit Objektiv-Steuerring sowie einen raffinierten Adapter mit integriertem Filtereinschub für Variable-ND- oder Pol-Filter. Die Adapter sind spritzwassergeschützt und an alle lassen sich EF- wie auch EF-S-Optiken anschliessen, jedoch keine EF-M-Objektive der APS-C-Kameraserie von Canon.
Die EF-EOS-R-Adapter selbst sind linsenlos. Sie überbrücken nur die unterschiedlich langen Auflagemasse von EF- und RF-Bajonett und übertragen die Anschlusskontakte. Einschränkungen gibt es je nach Alter des Objektivs bei der Serienbildgeschwindigkeit und der nutzbaren Fläche für den Autofokus. Die Scharfstellung erfolgt jedoch tadellos.
So adaptierte ich gleich ein älteres EF 17–40 mm f/4.0 L, ein EF 24–70 mm f/2.8 L USM, ein EF 100 mm f/2.8 sowie das EF 70–200 mm f/4 L IS USM. Alle Objektive verhielten sich an der EOS R5 und R6 wie gewohnt und stellten beim Fotografieren ohne Probleme und erstaunlich zügig scharf. Das Canon RF 24–105 mm war jedoch klar schneller beim Fokussieren und vor allem leiser.
 Adapter sei Dank: Vorhandene Canon EF- und EF-S-Objektive lassen sich mittels Zwischenstück an der EOS R5 und R6 andocken. Im Bild der Adapter für Drop-In-Filter mit einem Pol-Filter.
Adapter sei Dank: Vorhandene Canon EF- und EF-S-Objektive lassen sich mittels Zwischenstück an der EOS R5 und R6 andocken. Im Bild der Adapter für Drop-In-Filter mit einem Pol-Filter.

 Alle Themen
Alle Themen