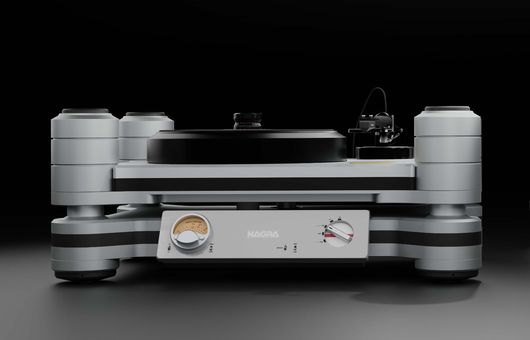Reisekopfhörer für alle Altersklassen
"Dieser Hörer klingt wirklich gut, er schirmt den Umgebungslärm tadellos ab und sitzt erst noch angenehm an den Ohren", meinte die junge Dame – in ihrer Freizeit eine begeisterte Querflötenspielerin – anlässlich des Fotoshootings. Diese spontanen Urteile beweisen, dass die junge Generation sehr wohl in der Lage ist, die Unterschiede zwischen Ramsch- und Qualitätsprodukten zu bemerken und zu schätzen.
Doch der PXC 480 ist kein eigentlicher Jugend- oder typischer Street-Kopfhörer, sondern ganz einfach ein hochwertiger HiFi-Kopfhörer mit Headsetfunktion für alle Altersklassen. Gerade auf Reisen kann er seine Fähigkeiten voll entfalten.
Erhalt der Hörfähigkeit
Die nicht nur für unsere musikbegeisterte Flötenspielerin verblüffende Wirkung des Lärmkillers – sprich NoiseGard-Hybrid – macht es zudem möglich, auch in lärmiger Umgebung mit vernünftigen Schallpegeln und ohne das Gehör dauerhaft zu schädigen, den erhofften Sound-Kick zu erleben. Gerade wenn es um den Erhalt der Hörfähigkeit der heutigen Jugend geht, gilt: Qualität vor Quantität! Bekannt ist, dass gerade junge Leute sehr oft in lärmiger Umgebung mit qualitativ minderwertig und unvernünftig laut aufspielenden Kopfhörern und gehörschädigenden Schallpegeln Musik hören.


 Alle Themen
Alle Themen